Umweltschutz
Umweltverschmutzung ist ein ernstes, globales Problem, das unsere Gesundheit und die Natur stark belastet. Mikroplastik im menschlichen Blut und die hohe Luftverschmutzung sind nur zwei Beispiele, die zeigen, wie dringend es ist, etwas zu ändern. Auch in Liechtenstein gibt es Umwelt-Herausforderungen, aber ebenso Fortschritte und Massnahmen zum Schutz unserer Umwelt.
Wie ist die aktuelle Situation?
Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jährlich etwa 7 Mio. Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung. In Europa ist die Luftverschmutzung das grösste umweltbedingte Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung
Seit mehreren Jahrzehnten sinkt die Stickoxid-Belastung stetig. Beispielsweise lag der Jahresmittelwert von vier in Liechtenstein verteilten Messstationen im Jahr 2006 bei 38 µg/m3 und im Jahr 2022 noch bei 19 µg/m3. Der Immissionsgrenzwert für den Jahresdurchschnitt beträgt 30 µg/m3
Im Jahr 2022 wurde zum ersten Mal Plastik in menschlichen Blutproben gefunden. PET, das z.B. für Getränkeflaschen verwendet wird, kam dabei am häufigsten vor. Im selben Jahr hat die UNO-Umweltversammlung (UNEA) beschlossen, Verhandlungen über ein rechtlich verbindliches Abkommen zu Kunststoffen aufzunehmen. Diese sollen 2024 zu einer «Plastikkonvention» führen
Der Trinkwasserverbrauch pro Einwohnerin und Einwohner (inkl. Industrie- und Dienstleistungsunternehmen) hat sich in den letzten 40 Jahren fast halbiert. Im Jahr 2022 waren es noch 768 Liter. Es stammt aus Grundwasser (zu etwas mehr als der Hälfe) sowie aus Quellwasser.
2.2 Mia. Menschen haben kein sicheres Wasser zur Verfügung. Das heisst, es ist in der Nähe des Zuhauses nicht zugänglich und/oder es ist verunreinigt. So entwickeln sich immer wieder Epidemien wie z.B. Cholera
Im Jahr 2022 wurden pro Einwohnerin oder pro Einwohner 825 kg Siedlungsabfälle erzeugt. Bis in die Nullerjahre hatte die Menge über die Jahrzehnte stark zugenommen, doch mittlerweile sinkt die Pro-Kopf-Menge langsam wieder. Zwei Drittel davon werden rezykliert
Die Feinstaubkonzentration ist in den letzten Jahren zurückgegangen.
Die Werte für Feinstaub PM10 betrug 2006 25 µg/m3 und im Jahr 2020 12 µg/m3. Der Grenzwert für PM10 liegt bei 20 µg/m3
Seit 2021 wird auch Feinstaub PM2.5 gemessen. Der Grenzwert liegt hier bei 10 µg/m3. Im Durschnitt wurde in den letzten Jahren Werte um die 7 und 8 µg/m3 gemessen
Der Grenzwert für bodennahes Ozon, der als 1-Stunden-Mittelwert 120 µg/m3 nicht überschreiten darf, wird v.a. in den Sommermonaten häufig überschritten
Was sind die Hauptursachen der Umweltverschmutzung?
Menschliche Aktivität
Die Umwelt kann durch verschiedene menschliche Aktivitäten belastet werden, die Luft, Böden und Gewässer beeinträchtigen können. Hier einige Beispiele.
Abgase und Reifenabrieb vom Strassenverkehr
Emissionen durch Heizungen
Einträge von Pflanzenschutz- und Düngemittel aus der Landwirtschaft
Emissionen von Schadstoffen aus der Industrie und Gewerbe
Unsachgemässe Abfallentsorgung
Chemikalien
Chemikalien gelangen auf vielfältige Weise in die Umwelt und können zahlreiche Ökosysteme belasten.
Freisetzung von Chemikalien bei der Gewinnung, Herstellung und Verarbeitung
Belastung während der Nutzung, dem Recycling und in der Entsorgung von Produkten
Verbreitung in Luft, Grundwasser, Oberflächengewässer, Klärschlamm und Boden
Aufnahme in Organismen und Weitergabe in Nahrungsketten
Beispiel eines grossen Chemieunfalls: Grossbrand in der «Schweizerhalle» bei Basel
Lichtverschmutzung
Lichtverschmutzung, also störendes Kunstlicht, ist eine Form der Umweltverschmutzung.
Lichtverschmutzung beeinträchtigt Insekten und Vögel, stört deren Orientierung und Lebensrhythmen
Auch der Mensch wird durch nächtliches Kunstlicht negativ beeinflusst, z.B. durch gestörte Schlafrhythmen
Lärmbelastung
Lärm ist eine Form der Umweltverschmutzung, die die Gesundheit beeinträchtigen kann.
Lärmverschmutzung entsteht durch Strassenverkehr, Baustellen und andere Quellen
Lärmbelastung hat negative Folgen für die körperliche Gesundheit
Psychische Gesundheit kann durch anhaltenden Lärm ebenfalls stark beeinträchtigt werden
Was sind die Folgen von Umweltverschmutzungen?

Luftverschmutzung kann Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen
Wasserverschmutzung führt zu Magen-Darm-Erkrankungen und Infektionen
Verschmutztes Wasser erhöht das Risiko von Krankheitsausbrüchen und Trinkwasserknappheit
Hohe Kosten entstehen durch Gesundheitsversorgung und Sanierung

Durch die Emission von Treibhausgasen wird der Klimawandel weiter vorangetrieben
Klimawandel verschärft Umweltprobleme wie Dürre, Hochwasser und Verlust von Lebensräumen
Verschlechterte Lebensbedingungen wirken sich negativ auf Mensch und Natur aus und belasten die Wirtschaft

Schadstoffe und Umweltbelastungen bedrohen die Vielfalt von Pflanzen- und Tierarten
Chemikalien und Abfälle kontaminieren Böden und gefährden die Nahrungsmittelproduktion
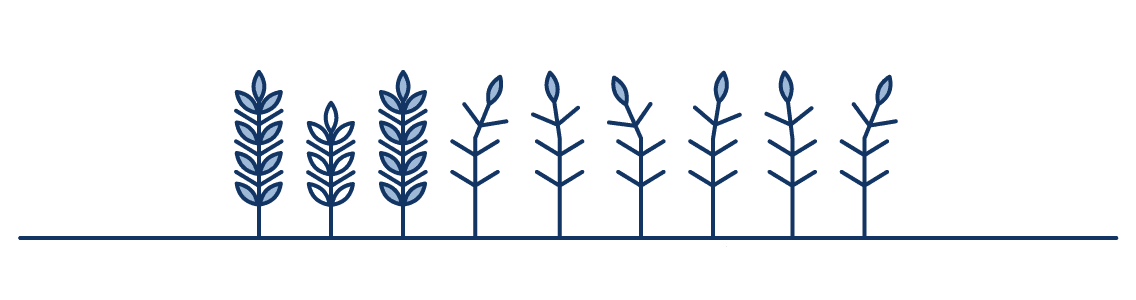
Schadstoffe in Wasser und Böden verschmutzen Lebensräume und gefährden Flora und Fauna
Verschmutzte Ökosysteme reduzieren die Biodiversität
Übermässige Wassernutzung führt zu Wasserknappheit und Bodenaustrocknung, was zur Wüstenbildung beiträgt
Versiegelte Flächen und Gewässerverbauungen beeinträchtigen die Vernetzung von Lebensräumen
Was unternimmt Liechtenstein für den Umweltschutz?
Umweltschutz ist eine grundlegende und interdisziplinäre Aufgabe. So heisst es beispielsweise im Umweltschutzgesetz, dass «Menschen, Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen geschützt sowie die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische Vielfalt, die Bodenfruchtbarkeit sowie die Wasser- und Luftqualität, dauerhaft erhalten werden sollen»
Die Grundlage zum alltäglichen, gelebten Umweltschutz sind
Umweltschutzgesetz
Verordnungen zu Lärmschutz
Verordnung zu Luftreinhaltung
Verordnung zu Gewässerschutz
Verordnung zu Abfallwirtschaft
OSTLUFT ist ein Zusammenschluss der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein zur Überwachung der Luftqualität (aktuelle Werte zu verschiedenen Luftschadstoffen wie Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid)

Wasser und seine gute Qualität sind grundlegend für unser Leben.
Die Gemeinden bauen und betreiben die Anlagen zur Trink-, Brauch- und Löschwasserversorgung
Die Gebiete zur Trinkwassergewinnung sind zudem raumplanerisch geschützt
Hier kann die Wasserqualität des eigenen Wohnorts überprüft werden
Boden ist in Liechtenstein eines der knappsten und somit wertvollsten Güter. Die Nahrungsmittelproduktion ist auf die fruchtbare Erdschicht angewiesen. Daher sind Mindestanteile der Gemeindeflächen als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen und werden gegen Zweckentfremdung gesetzlich geschützt

Chemikalien sind in vielen Alltagsprodukten wie Putzmitteln, Farben und Lösungsmitteln enthalten. Die entsprechenden Rechtsvorschriften der Schweiz (Chemikaliengesetz) sind durch den Zollvertrag auch bei uns direkt anwendbar

Liechtenstein ist vertreten im Cercle Bruit, der Vereinigung kantonaler Lärmschutzfachleute, die die Lärmbekämpfung in der Schweiz und Liechtenstein fördert.
Eine effektive Massnahem sind lärmarme Beläge gegen Strassenverkehrslärm. In Schaan wird derzeit ein solcher Belag auf seine langjährige Wirkung getestet
Elektrosmog entsteht überall, wo Strom fliesst. Gesetzliche Verordnungen begrenzen die Strahlung ortsfester Anlagen wie Hochspannungsleitungen und Mobilfunksender
Die Abfallentsorgung in Liechtenstein wird über den Entsorgungszweckverband der Gemeinden Liechtensteins (EZV) organisiert. Im Abfallkalender sind alle Abholtermine für Kehricht und Grünabfuhr aufgeführt. Verschiedene Abfallarten werden separat gesammelt und recycelt, um neue Werkstoffe zu gewinnen
Abwasserreinigungsanlagen leisten einen wesentlichen Beitrag zu sauberen Gewässern, indem sie einen Grossteil der problematischen Schadstoffe eliminieren
Erstaunliche Fakten
Die globale Biomasse von Wildsäugetieren ist in den vergangenen 100 Jahren um 82% zurückgegangen.
Schätzungen gehen davon aus, dass die Ökosystemleistungen einen Nutzen von 125 bis 140 Bio. US-Dollar pro Jahr erbringen, d.h. mehr als das 1,5-Fache des globalen Bruttoinlandsprodukts.
Die Artenvielfalt der Pflanzen im Kulturland schwindet. Um 1900 wurden auf einer Wiesen- und Weidefläche von 30 x 30 cm (= 0.09 m2) so viele Arten gefunden wie heute auf 25 m2 nicht mehr.


